Tristesse: Unterschied zwischen den Versionen
(→Alltag und Massenproduktion: Bild gewechselt) |
|||
| (14 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | Die '''Tristesse''' ({{IPA| | + | Die '''Tristesse''' ([[Französische Sprache|frz.]] [{{IPA|tʀisˈtɛs}}] „Trauer; Traurigkeit“) bezeichnet ein [[Gefühl]] oder einen [[Ästhetik|ästhetischen Eindruck]] der [[Traurigkeit]], der Trübseligkeit, des [[Jammer]]s oder der Ödnis. Sie kann sowohl zur Beschreibung von [[Emotion]]en oder [[Stimmung (Psychologie)|Stimmungen]] als auch zur Bezeichnung von Zuständen, Gegenständen oder Orten verwendet werden. In diesem Fall drückt der Begriff [[Langeweile]], Geistlosigkeit oder Mangel an Abwechslung aus. |
Häufiger als das Substantiv ''Tristesse'' wird im Deutschen das Adjektiv ''trist'' verwendet. Der Begriff wurde gegen Ende des 18. Jahrhunderts von deutschen Studenten vom [[Französische Sprache|französischen]] Wort ''triste'' abgeleitet. In der ersten Zeit nach der Übernahme des französischen [[Fremdwort]]s findet sich des Öfteren dessen End-E auch in der deutschen Sprache. Das gesamte Wortfeld gilt als negativ [[Konnotation|konnotiert]]. | Häufiger als das Substantiv ''Tristesse'' wird im Deutschen das Adjektiv ''trist'' verwendet. Der Begriff wurde gegen Ende des 18. Jahrhunderts von deutschen Studenten vom [[Französische Sprache|französischen]] Wort ''triste'' abgeleitet. In der ersten Zeit nach der Übernahme des französischen [[Fremdwort]]s findet sich des Öfteren dessen End-E auch in der deutschen Sprache. Das gesamte Wortfeld gilt als negativ [[Konnotation|konnotiert]]. | ||
| Zeile 9: | Zeile 9: | ||
Tristesse wird in Deutschland seit Ende des 18. Jahrhunderts verwendet. Der Begriff ist ein Lehnwort aus dem [[Französische Sprache|Französischen]]. Nach [[Friedrich Seiler]] wurde er aus einem Bedürfnis nach reicherer und feinerer Abtönung des Ausdrucks, das aus einer zunehmenden Vertiefung und Verfeinerung der Anschauung resultiert, zusammen mit einer ganzen Reihe von Beiwörtern übernommen.<ref>Friedrich Seiler: ''Die Entwicklung der deutschen Kultur im Spiegel des deutschen Lehnworts''. Verlag der Buchhandlung des Waisenhauses, Halle an der Saale 1912, S. 213ff.</ref> | Tristesse wird in Deutschland seit Ende des 18. Jahrhunderts verwendet. Der Begriff ist ein Lehnwort aus dem [[Französische Sprache|Französischen]]. Nach [[Friedrich Seiler]] wurde er aus einem Bedürfnis nach reicherer und feinerer Abtönung des Ausdrucks, das aus einer zunehmenden Vertiefung und Verfeinerung der Anschauung resultiert, zusammen mit einer ganzen Reihe von Beiwörtern übernommen.<ref>Friedrich Seiler: ''Die Entwicklung der deutschen Kultur im Spiegel des deutschen Lehnworts''. Verlag der Buchhandlung des Waisenhauses, Halle an der Saale 1912, S. 213ff.</ref> | ||
| − | Bei der | + | Bei der Entlehnung des Worts fand ein Bedeutungswandel statt, bedeutet Tristesse im Französischen noch einfach „Traurigkeit“, erhielt der Begriff im Deutschen eine ästhetische Dimension. Eine enge Verzahnung zwischen Emotion und Ästhetik ist jedoch schon alt. [[Augustinus von Hippo]] fragte in seiner Schrift ''[[De vera religione]]'' schon im 4. Jahrhundert: ''Quaeram utrum ideo pulchra sint, quia delectant; an ideo delectent, quia pulchra sunt.'' (Sind die Schönen Dinge deshalb schön, weil sie Freude bereiten, oder bereiten sie Freude, weil sie schön sind?)<ref>Augustinus von Hippo: ''De vera religione'', Kapitel 32.</ref> Eine Verwendung emotionaler Termini zur Beschreibung ästhetischen Empfindens ist zudem im Deutschen häufig (Beispiele: ''ein trauriges Bild'', ''ein freundliches Arrangement''). |
Im Französischen ist der Begriff erstmals 1145 in einer Schrift des normannischen Dichters [[Wace]] mit dem Titel ''La conception de Notre Dame'' belegt.<ref>Wace: ''La conception de Notre Dame''. Herausgegeben von W. R. Ashford. University of Chicago, Chicago 1933, Seite 469.</ref> Zu finden ist das Wort auch in dem ''Roman de Troie'' des [[Bénoît de Sainte-Maure]] aus dem 12. Jahrhundert.<ref>Bénoît de Sainte-Maure: ''Roman de Troie''. Herausgegeben von L. Constans. Firmin Didot, Paris 1904, Seite 5260.</ref> Beispiele für die Verwendung des Wortes ''tristesse'' im 17. Jahrhundert sind 1683 bei [[Nicolas Boileau]]<ref>Nicolas Boileau: ''Le Lutrin''. In: Ch.-H. Boudhors (Hrsg.): ''Odes''. 2. Auflage, Paris 1960, Seite 165.</ref> oder 1611 bei [[Randle Cotgrave]]<ref>Randle Cotgrave: ''A Dictionarie French and English. Published for the benefite of the studious in that language.'' Reprint, Edition Olms, Hombrechtikon / Zürich 1977. ISBN 9999082823</ref> zu lesen. Im späten 19. Jahrhundert finden sie sich unter anderem bei [[Léon Cladel]] in ''Ompdrailles, le Tombeau-des-Lutteurs'' aus dem Jahr 1879.<ref>Léon Cladel: ''Ompdrailles, le Tombeau-des-Lutteurs''. Cinqualbre, Paris 1879, Seite 103.</ref> | Im Französischen ist der Begriff erstmals 1145 in einer Schrift des normannischen Dichters [[Wace]] mit dem Titel ''La conception de Notre Dame'' belegt.<ref>Wace: ''La conception de Notre Dame''. Herausgegeben von W. R. Ashford. University of Chicago, Chicago 1933, Seite 469.</ref> Zu finden ist das Wort auch in dem ''Roman de Troie'' des [[Bénoît de Sainte-Maure]] aus dem 12. Jahrhundert.<ref>Bénoît de Sainte-Maure: ''Roman de Troie''. Herausgegeben von L. Constans. Firmin Didot, Paris 1904, Seite 5260.</ref> Beispiele für die Verwendung des Wortes ''tristesse'' im 17. Jahrhundert sind 1683 bei [[Nicolas Boileau]]<ref>Nicolas Boileau: ''Le Lutrin''. In: Ch.-H. Boudhors (Hrsg.): ''Odes''. 2. Auflage, Paris 1960, Seite 165.</ref> oder 1611 bei [[Randle Cotgrave]]<ref>Randle Cotgrave: ''A Dictionarie French and English. Published for the benefite of the studious in that language.'' Reprint, Edition Olms, Hombrechtikon / Zürich 1977. ISBN 9999082823</ref> zu lesen. Im späten 19. Jahrhundert finden sie sich unter anderem bei [[Léon Cladel]] in ''Ompdrailles, le Tombeau-des-Lutteurs'' aus dem Jahr 1879.<ref>Léon Cladel: ''Ompdrailles, le Tombeau-des-Lutteurs''. Cinqualbre, Paris 1879, Seite 103.</ref> | ||
| Zeile 16: | Zeile 16: | ||
Gemeinsame Wurzel ist aber das [[Latein|lateinische]] Wort ''tristis'', das verschiedene Bedeutungen hatte. Im Gebrauch mit ''fatum'' (das Schicksal), ''morbus'' (der Tod), oder ''bellum'' (der Krieg) lässt es sich als „unglücksverheißend, trauerbringend, unheilvoll oder gefährlich“ übersetzen. In der Verwendung bei ''senex'' (das Alter) oder ''vita'' (das Leben) wird es jedoch häufig als „unfreundlich, ernst oder streng“ aufgefasst. Bei [[Charon von Lampsakos]] findet sich ''tristis'' bei ''vultus'' (die Miene) oder ''navita'' (der Seemann) in der Bedeutung „grimmig, hart“ oder „finster“. In Verbindung mit ''sapor'' (der Geschmack) kann es aber auch mit „bitter, herb“ oder „widerlich“ übersetzt werden. Mit ''amici'' (der Freund) heißt es schließlich „traurig“. Das zugehörige Sustantiv ''tristitia'' wird vor allem in der Bedeutung „die Traurigkeit“ verwendet.<ref>J. M. Stowasser, M. Petschenig und F. Skutsch: ''Stowasser. Lateinisch-deutsches Schulwörterbuch''. Wien 1994, Seiten 524f. ISBN 3209014957</ref> | Gemeinsame Wurzel ist aber das [[Latein|lateinische]] Wort ''tristis'', das verschiedene Bedeutungen hatte. Im Gebrauch mit ''fatum'' (das Schicksal), ''morbus'' (der Tod), oder ''bellum'' (der Krieg) lässt es sich als „unglücksverheißend, trauerbringend, unheilvoll oder gefährlich“ übersetzen. In der Verwendung bei ''senex'' (das Alter) oder ''vita'' (das Leben) wird es jedoch häufig als „unfreundlich, ernst oder streng“ aufgefasst. Bei [[Charon von Lampsakos]] findet sich ''tristis'' bei ''vultus'' (die Miene) oder ''navita'' (der Seemann) in der Bedeutung „grimmig, hart“ oder „finster“. In Verbindung mit ''sapor'' (der Geschmack) kann es aber auch mit „bitter, herb“ oder „widerlich“ übersetzt werden. Mit ''amici'' (der Freund) heißt es schließlich „traurig“. Das zugehörige Sustantiv ''tristitia'' wird vor allem in der Bedeutung „die Traurigkeit“ verwendet.<ref>J. M. Stowasser, M. Petschenig und F. Skutsch: ''Stowasser. Lateinisch-deutsches Schulwörterbuch''. Wien 1994, Seiten 524f. ISBN 3209014957</ref> | ||
| + | |||
| + | Das lateinische Wort ''tristis'' geht wiederum auf das [[Altgriechische Sprache|altgriechische]] δρίμύς (''drimos'') zurück, das mit „durchdringend, scharf, herb oder bitter“ übersetzt wird.<ref>Hermann Osthoff: ''Morphologische Untersuchungen auf dem Gebiete der indogermanischen Sprachen.'' Olms, Leipzig, Nachdruck 1974. ISBN 3487050803</ref> Verwandtschaft scheint aber auch zum [[Altenglische Sprache|angelsächsischen]] ''priste'' in der Bedeutung „kühn, dreist“ und ''praestan'', das „drücken“ bedeutet, zu bestehen. [[Wurzel (Linguistik)|Sprachwurzel]] wäre dann ''treis'', das mit „pressen“ übersetzt wird.<ref>Henry Lewis und Holger Pedersen: ''A Concise Comparative Celtic Grammar.'' 3. Auflage, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen, 1989. ISBN 9783525261026</ref> | ||
== Wahrnehmung des Tristen == | == Wahrnehmung des Tristen == | ||
| Zeile 38: | Zeile 40: | ||
Für viele Menschen ist der Begriff [[Alltag]] zum Inbegriff von Tristesse geworden. Ihnen fällt es schwer, sich an die Monotonie routinemäßig ablaufender Zeitzyklen zu gewöhnen. Insbesondere die Alltagsverliebtheit des abfällig bezeichneten [[Spießbürger]]tums und des [[Kleinbürger]]tums wird häufig als trist empfunden. Sie wurde Motiv vieler künstlerischer Umsetzungen; besonders [[Hermann Hesse]] ist bekannt für seine Hassliebe auf die [[Pedanterie]] der Bürgerlichkeit. | Für viele Menschen ist der Begriff [[Alltag]] zum Inbegriff von Tristesse geworden. Ihnen fällt es schwer, sich an die Monotonie routinemäßig ablaufender Zeitzyklen zu gewöhnen. Insbesondere die Alltagsverliebtheit des abfällig bezeichneten [[Spießbürger]]tums und des [[Kleinbürger]]tums wird häufig als trist empfunden. Sie wurde Motiv vieler künstlerischer Umsetzungen; besonders [[Hermann Hesse]] ist bekannt für seine Hassliebe auf die [[Pedanterie]] der Bürgerlichkeit. | ||
| − | :„''Ich habe das gern, auf der Treppe diesen Geruch von Stille, Ordnung und Sauberkeit, Anstand und Zahmheit zu atmen, der trotz meinem Bürgerhass immer etwas rührendes für mich hat, und ich habe es gern, dann über die Schwelle meines Zimmers zu treten, wo das alles aufhört, | + | :„''Ich habe das gern, auf der Treppe diesen Geruch von Stille, Ordnung und Sauberkeit, Anstand und Zahmheit zu atmen, der trotz meinem Bürgerhass immer etwas rührendes für mich hat, und ich habe es gern, dann über die Schwelle meines Zimmers zu treten, wo das alles aufhört, …''“<ref>Hermann Hesse: ''Der Steppenwolf.'' in ''Gesammelte Werke, Band 10.'' Suhrkamp, Frankfurt am Main 1987. Seite 208. ISBN 3518381008''</ref> |
Andererseits erfreut sich der Alltag auch immer wieder einer großen Beliebtheit. [[Siegfried Kracauer]] entdeckt sogar eine neue „''Exotik des Alltags''“.<ref>Siegfried Kracauer: ''Die Angestellten.'' Suhrkamp, Frankfurt am Main, 1980. Seite 11. ISBN 3518365134</ref> In der Tat scheinen viele Menschen bemüht zu sein, die Tristesse des Alltags zu überwinden. | Andererseits erfreut sich der Alltag auch immer wieder einer großen Beliebtheit. [[Siegfried Kracauer]] entdeckt sogar eine neue „''Exotik des Alltags''“.<ref>Siegfried Kracauer: ''Die Angestellten.'' Suhrkamp, Frankfurt am Main, 1980. Seite 11. ISBN 3518365134</ref> In der Tat scheinen viele Menschen bemüht zu sein, die Tristesse des Alltags zu überwinden. | ||
| Zeile 69: | Zeile 71: | ||
=== Musik === | === Musik === | ||
| − | In der [[Musik]] wird Tristesse vor allem durch [[Monotonie (Phonetik)|Eintönigkeit]] erreicht, aber auch schwere [[Moll]]-Akkorde erzeugen beim Hörer ein düsteres, tristes Empfinden. Fritz Göttler beschreibt [[Wolfgang Amadeus Mozart|Mozarts]] ''[[Die Zauberflöte]]'' als Inbegriff der europäischen Tristesse.<ref>Fritz Göttler: ''Im Geiste Mozarts'' in ''Filmmuseum München, Programmheft 01/07'' [http://www.stadtmuseum-online.de/aktuell/progheft10.pdf] (PDF)</ref> Generell gilt, dass der Eindruck, den eine Musik hinterlässt, umso trister ist, je häufiger sie gehört wird. Gute Musik kann jedoch dazu dienen, phantastische Freiräume zu schaffen – als Ansporn, der tristen Realität zu entfliehen. | + | In der [[Musik]] wird Tristesse vor allem durch [[Monotonie (Phonetik)|Eintönigkeit]] erreicht, aber auch schwere [[Moll (Musik)|Moll]]-Akkorde erzeugen beim Hörer ein düsteres, tristes Empfinden. Fritz Göttler beschreibt [[Wolfgang Amadeus Mozart|Mozarts]] ''[[Die Zauberflöte]]'' als Inbegriff der europäischen Tristesse.<ref>Fritz Göttler: ''Im Geiste Mozarts'' in ''Filmmuseum München, Programmheft 01/07'' [http://www.stadtmuseum-online.de/aktuell/progheft10.pdf] (PDF)</ref> Generell gilt, dass der Eindruck, den eine Musik hinterlässt, umso trister ist, je häufiger sie gehört wird. Gute Musik kann jedoch dazu dienen, phantastische Freiräume zu schaffen – als Ansporn, der tristen Realität zu entfliehen. |
[[Bild:Water drop animation enhanced small.gif|thumb|left|[[George Brecht]] vertonte das Tropfen eines Wasserhahns]] | [[Bild:Water drop animation enhanced small.gif|thumb|left|[[George Brecht]] vertonte das Tropfen eines Wasserhahns]] | ||
| Zeile 118: | Zeile 120: | ||
Triste Landschaften sind auch im nordischen Film verbreitet. Bei ''[[Nói Albínói]],'' einem [[Island|isländischen]] Film von [[Dagur Kári]], wird die Tristesse eines einsamen Dorfes auf Island beschrieben. Der [[Norwegen|norwegische]] Film ''[[Kitchen Stories]]'' von [[Bent Hamer]] thematisiert die Alltagstristesse eines einsamen alten Mannes. Der finnische Regisseur [[Aki Kaurismäki]] ist berühmt für seine tristen Kompositionen, so dass er als der „''Chef-Melancholiker des europäischen Autorenkinos''“ gilt.<ref>Rainer Gansera: ''Down and Out in Helsinki und Hof, Begegnung mit Aki Kaurismäki.'' In: ''epd Film 12/2006'', Seite 25</ref> | Triste Landschaften sind auch im nordischen Film verbreitet. Bei ''[[Nói Albínói]],'' einem [[Island|isländischen]] Film von [[Dagur Kári]], wird die Tristesse eines einsamen Dorfes auf Island beschrieben. Der [[Norwegen|norwegische]] Film ''[[Kitchen Stories]]'' von [[Bent Hamer]] thematisiert die Alltagstristesse eines einsamen alten Mannes. Der finnische Regisseur [[Aki Kaurismäki]] ist berühmt für seine tristen Kompositionen, so dass er als der „''Chef-Melancholiker des europäischen Autorenkinos''“ gilt.<ref>Rainer Gansera: ''Down and Out in Helsinki und Hof, Begegnung mit Aki Kaurismäki.'' In: ''epd Film 12/2006'', Seite 25</ref> | ||
| − | Im US-Film steht Handlung mehr im Vordergrund; zwar wirken Filme von [[David Lynch]] ''([[Lost Highway]])'' oder [[Russ Meyer]] ''([[Die Satansweiber von Tittfield]])'' bedrohlich und düster, diese Filme sind jedoch so reich an [[Action]], dass sich Tristesse als Emotion nicht einstellt. Dies gilt auch für Endzeitfilme wie ''[[Der Tag danach]]'' oder ''[[Mad Max]],'' die im Gegensatz zu ''Stalker,'' sehr handlungsreich und schnell sind. | + | Im US-Film steht Handlung mehr im Vordergrund; zwar wirken Filme von [[David Lynch]] ''([[Lost Highway (Film)|Lost Highway]])'' oder [[Russ Meyer]] ''([[Die Satansweiber von Tittfield]])'' bedrohlich und düster, diese Filme sind jedoch so reich an [[Actionfilm|Action]], dass sich Tristesse als Emotion nicht einstellt. Dies gilt auch für Endzeitfilme wie ''[[Der Tag danach]]'' oder ''[[Mad Max]],'' die im Gegensatz zu ''Stalker,'' sehr handlungsreich und schnell sind. |
=== Architektur === | === Architektur === | ||
| Zeile 134: | Zeile 136: | ||
Dieser Phase folgte eine triste und schmucklose Phase der [[Klassische Moderne|Klassischen Moderne]], in Deutschland als [[Bauhaus]] bekannt. | Dieser Phase folgte eine triste und schmucklose Phase der [[Klassische Moderne|Klassischen Moderne]], in Deutschland als [[Bauhaus]] bekannt. | ||
| − | : ''Infolge der jammervollen Wohnverhältnisse in den | + | : ''Infolge der jammervollen Wohnverhältnisse in den Mietskasernen ist es vielfach sogar den besten Eltern nicht möglich, ihre Kinder körperlich, geistig und seelisch zu tüchtigen Menschen zu erziehen. Die Folgen der Tristesse sind Beschränkung der Kinderzahl und Ehelosigkeit.''<ref>Handbibliothek für Bauingenieure, Städtebau, Prof. Dr. Otto Blum, Verlag von Julius Springer 1937, Seite 13</ref> |
Triste Gebäude bestehen aus einfachen geometrischen Formen, meist Quadern. Schmuckelemente sind selten oder nicht vorhanden. Für die Umsetzung dieser Bauform haben sich weitgehend Betonfertigteile durchgesetzt, die eine sehr effektive Bauweise darstellen. Ab Mitte der 1980er Jahre war der Trend zu erkennen, Plattenbauten mit Schmuckelementen zu versehen oder die Bauweise weniger deutlich zum Ausdruck zu bringen. Ein typisches Beispiel hierfür ist das [[Nikolaiviertel]] in Berlin-Mitte. | Triste Gebäude bestehen aus einfachen geometrischen Formen, meist Quadern. Schmuckelemente sind selten oder nicht vorhanden. Für die Umsetzung dieser Bauform haben sich weitgehend Betonfertigteile durchgesetzt, die eine sehr effektive Bauweise darstellen. Ab Mitte der 1980er Jahre war der Trend zu erkennen, Plattenbauten mit Schmuckelementen zu versehen oder die Bauweise weniger deutlich zum Ausdruck zu bringen. Ein typisches Beispiel hierfür ist das [[Nikolaiviertel]] in Berlin-Mitte. | ||
| − | Durch einfache, aber massenhaft einsetzbare Gestaltungsmittel wurde versucht, den tristen Charakter der Gebäude etwas abwechslungsreicher zu gestalten. So wurde als Außenverkleidung gewaschener Kies oder Fliesen verwendet. Die anfangs rechtwinklige Anordnung der verschiedenen Wohnblöcke schafft bei höheren Häusern Schluchten, die die vorhandene Windgeschwindigkeit teilweise drastisch erhöht. Aus diesem Grund ist es in Neubauvierteln quasi nie windstill und die Geräusche des Windes erzeugen eine anhaltende | + | Durch einfache, aber massenhaft einsetzbare Gestaltungsmittel wurde versucht, den tristen Charakter der Gebäude etwas abwechslungsreicher zu gestalten. So wurde als Außenverkleidung gewaschener Kies oder Fliesen verwendet. Die anfangs rechtwinklige Anordnung der verschiedenen Wohnblöcke schafft bei höheren Häusern Schluchten, die die vorhandene Windgeschwindigkeit teilweise drastisch erhöht. Aus diesem Grund ist es in Neubauvierteln quasi nie windstill und die Geräusche des Windes erzeugen eine anhaltende – wenn auch geringe – [[Lärmemission]]. Diese Windgeräusche machen derartige Wohngegenden zusätzlich unangenehm. Aus diesem Grund wurden ab etwa 1980 Neubaugebiete nicht mehr durchgängig rechtwinklig errichtet. |
Als trist wird auch oft funktionale Industriearchitektur angesehen. Seit der [[Klassische Moderne|Klassischen Moderne]] sind Industriebauten weitgehend schmucklos, die Form folgt der Funktion. Farben wurden nur verwendet, wenn sie einen baulichen Grund hatten, beispielsweise als Rostschutz. So entstanden Bauwerke, die allerorten weitgehend gleich aussehen. Dieser Trend wird erst in den letzten Jahrzehnten gebrochen. Industriebauten bleiben weiterhin relativ schmucklos, erhalten aber bunte Farben sowie Farbkontraste. | Als trist wird auch oft funktionale Industriearchitektur angesehen. Seit der [[Klassische Moderne|Klassischen Moderne]] sind Industriebauten weitgehend schmucklos, die Form folgt der Funktion. Farben wurden nur verwendet, wenn sie einen baulichen Grund hatten, beispielsweise als Rostschutz. So entstanden Bauwerke, die allerorten weitgehend gleich aussehen. Dieser Trend wird erst in den letzten Jahrzehnten gebrochen. Industriebauten bleiben weiterhin relativ schmucklos, erhalten aber bunte Farben sowie Farbkontraste. | ||
| Zeile 167: | Zeile 169: | ||
{{Lesenswert}} | {{Lesenswert}} | ||
| + | {{Exzellent Kandidat}} | ||
Version vom 13. Oktober 2007, 23:56 Uhr
Die Tristesse (frz. [tʀisˈtɛs] „Trauer; Traurigkeit“) bezeichnet ein Gefühl oder einen ästhetischen Eindruck der Traurigkeit, der Trübseligkeit, des Jammers oder der Ödnis. Sie kann sowohl zur Beschreibung von Emotionen oder Stimmungen als auch zur Bezeichnung von Zuständen, Gegenständen oder Orten verwendet werden. In diesem Fall drückt der Begriff Langeweile, Geistlosigkeit oder Mangel an Abwechslung aus.
Häufiger als das Substantiv Tristesse wird im Deutschen das Adjektiv trist verwendet. Der Begriff wurde gegen Ende des 18. Jahrhunderts von deutschen Studenten vom französischen Wort triste abgeleitet. In der ersten Zeit nach der Übernahme des französischen Fremdworts findet sich des Öfteren dessen End-E auch in der deutschen Sprache. Das gesamte Wortfeld gilt als negativ konnotiert.
Im 20. Jahrhundert ging das Adjektiv trist in den deutschen Wortschatz über, wohingegen das Substantiv Tristesse immer noch als französisches Fremdwort erkennbar ist und vorwiegend in akademischen Kreisen verwendet wird.
Inhaltsverzeichnis
Etymologie und Wortgeschichte
Tristesse wird in Deutschland seit Ende des 18. Jahrhunderts verwendet. Der Begriff ist ein Lehnwort aus dem Französischen. Nach Friedrich Seiler wurde er aus einem Bedürfnis nach reicherer und feinerer Abtönung des Ausdrucks, das aus einer zunehmenden Vertiefung und Verfeinerung der Anschauung resultiert, zusammen mit einer ganzen Reihe von Beiwörtern übernommen.[1]
Bei der Entlehnung des Worts fand ein Bedeutungswandel statt, bedeutet Tristesse im Französischen noch einfach „Traurigkeit“, erhielt der Begriff im Deutschen eine ästhetische Dimension. Eine enge Verzahnung zwischen Emotion und Ästhetik ist jedoch schon alt. Augustinus von Hippo fragte in seiner Schrift De vera religione schon im 4. Jahrhundert: Quaeram utrum ideo pulchra sint, quia delectant; an ideo delectent, quia pulchra sunt. (Sind die Schönen Dinge deshalb schön, weil sie Freude bereiten, oder bereiten sie Freude, weil sie schön sind?)[2] Eine Verwendung emotionaler Termini zur Beschreibung ästhetischen Empfindens ist zudem im Deutschen häufig (Beispiele: ein trauriges Bild, ein freundliches Arrangement).
Im Französischen ist der Begriff erstmals 1145 in einer Schrift des normannischen Dichters Wace mit dem Titel La conception de Notre Dame belegt.[3] Zu finden ist das Wort auch in dem Roman de Troie des Bénoît de Sainte-Maure aus dem 12. Jahrhundert.[4] Beispiele für die Verwendung des Wortes tristesse im 17. Jahrhundert sind 1683 bei Nicolas Boileau[5] oder 1611 bei Randle Cotgrave[6] zu lesen. Im späten 19. Jahrhundert finden sie sich unter anderem bei Léon Cladel in Ompdrailles, le Tombeau-des-Lutteurs aus dem Jahr 1879.[7]
In den anderen stark vom Französischen beeinflussten Dialekten und Kleinsprachen ist der Terminus stets ähnlich, so wird aus dem französischen triste im Wallonischen triss und im Provenzalischen trist oder triste. Auch in anderen romanischen Sprachen bleibt der Wortstamm erhalten, Beispiele seien das italienische triste und das spanische triste.[8]
Gemeinsame Wurzel ist aber das lateinische Wort tristis, das verschiedene Bedeutungen hatte. Im Gebrauch mit fatum (das Schicksal), morbus (der Tod), oder bellum (der Krieg) lässt es sich als „unglücksverheißend, trauerbringend, unheilvoll oder gefährlich“ übersetzen. In der Verwendung bei senex (das Alter) oder vita (das Leben) wird es jedoch häufig als „unfreundlich, ernst oder streng“ aufgefasst. Bei Charon von Lampsakos findet sich tristis bei vultus (die Miene) oder navita (der Seemann) in der Bedeutung „grimmig, hart“ oder „finster“. In Verbindung mit sapor (der Geschmack) kann es aber auch mit „bitter, herb“ oder „widerlich“ übersetzt werden. Mit amici (der Freund) heißt es schließlich „traurig“. Das zugehörige Sustantiv tristitia wird vor allem in der Bedeutung „die Traurigkeit“ verwendet.[9]
Das lateinische Wort tristis geht wiederum auf das altgriechische δρίμύς (drimos) zurück, das mit „durchdringend, scharf, herb oder bitter“ übersetzt wird.[10] Verwandtschaft scheint aber auch zum angelsächsischen priste in der Bedeutung „kühn, dreist“ und praestan, das „drücken“ bedeutet, zu bestehen. Sprachwurzel wäre dann treis, das mit „pressen“ übersetzt wird.[11]
Wahrnehmung des Tristen
Kunstwerke gelten dann als schön, wenn sie facettenreich, reichhaltig und sinnstiftend sind.[12] Eine solche „schöne“ ästhetische Wahrnehmung lässt den Betrachter ein Glücksgefühl empfinden. So schrieb zum Beispiel schon Ludwig Wittgenstein:
- „Und das Schöne ist eben das, was glücklich macht.“[13]
Sparsame, abstrakte und triste Kunstwerke werden in der Regel als weniger schön empfunden und hinterlassen einen nachdenklichen, eher an die Kognition oder das formal-logische Denken im Sinne Piagets gerichteten, Eindruck. Sie erzeugen sogar eine eher traurige Stimmung. In einem Versuch der vergleichenden Bildbeurteilung, in dem Probanden eher triste Bilder von Piet Mondrian und farbenfrohe, fröhliche Bilder von Friedensreich Hundertwasser gezeigt wurden, gaben fast alle Teilnehmer an, dass die fröhlichen Bilder Hundertwassers schöner sind. 71% der Befragten gaben an, dass ihnen kräftige Farben generell besser gefallen als blasse Farben.[14]
Diese Verbindung von ästhetischem Eindruck und Emotion wird zum Beispiel in der Kunsttherapie verwendet, indem depressive Patienten angehalten werden, bunte Farben zu verwenden.
Auf der anderen Seite gelten triste Bilder als ehrlicher und realistischer. Bunten, fröhlichen Kunstwerken wird oft vorgeworfen, die Welt zu optimistisch zu zeigen oder sie zu entstellen.[15] Versucht eine betont anti-triste Darstellung traurige Aspekte zu übertünchen, wird dies wieder als eher depressiv wahrgenommen. So schreibt zum Beispiel Joyce McDougall über die Schwulenbewegung:
- „Die fröhliche ‚Tunten‘-Welt der Homosexuellen wird in zahlreichen Bars vorgeführt, doch ihre Farbenpracht und ‚gaiety‘ verbergen nur notdürftig ihre depressiven und häufig quälenden Aspekte.“[16]
Alltag und Massenproduktion
Für viele Menschen ist der Begriff Alltag zum Inbegriff von Tristesse geworden. Ihnen fällt es schwer, sich an die Monotonie routinemäßig ablaufender Zeitzyklen zu gewöhnen. Insbesondere die Alltagsverliebtheit des abfällig bezeichneten Spießbürgertums und des Kleinbürgertums wird häufig als trist empfunden. Sie wurde Motiv vieler künstlerischer Umsetzungen; besonders Hermann Hesse ist bekannt für seine Hassliebe auf die Pedanterie der Bürgerlichkeit.
- „Ich habe das gern, auf der Treppe diesen Geruch von Stille, Ordnung und Sauberkeit, Anstand und Zahmheit zu atmen, der trotz meinem Bürgerhass immer etwas rührendes für mich hat, und ich habe es gern, dann über die Schwelle meines Zimmers zu treten, wo das alles aufhört, …“[17]
Andererseits erfreut sich der Alltag auch immer wieder einer großen Beliebtheit. Siegfried Kracauer entdeckt sogar eine neue „Exotik des Alltags“.[18] In der Tat scheinen viele Menschen bemüht zu sein, die Tristesse des Alltags zu überwinden.
Oft wird auch die Fließbandfertigung und die industrielle Massenproduktion zur Metapher für das Gefühl der Tristesse. Die Vorstellung, unter Zwang immer wieder den gleichen Handgriff auszuführen, wirkt auf viele Menschen geradezu grotesk. Diese triste Umgebung wird zum Beispiel im Film Moderne Zeiten von Charles Chaplin karikiert.
Tristesse in der Kunst
Auch wenn ein trister Eindruck in der Kunst generell eher unerwünscht ist, wurde die Tristesse immer wieder zum Sujet, um eine gewisse Düsternis oder die menschliche Geworfenheit und Aussichtslosigkeit darzustellen.
Literatur – Bonjour Tristesse
In der deutschen Literatur finden sich die ersten Verwendungen des Wortes Anfang des 18. Jahrhunderts bei Franz von Gaudy („Tage und Wochen vergingen langweilig und triste bei Viertelsportionen“)[19] oder bei Christian Dietrich Grabbe („Oh, so musz ich den dicken Konrad holen, denn er ist wieder erschrecklich triste geworden, seitdem man die alte Chaussee ausbessert“).[20] Zu dieser Zeit war die Verwendung des Begriffs in der Literatur aber noch selten, er war leicht als Fremdwort zu erkennen und in seinem Bedeutungsgehalt unscharf und schillernd.
Johann Wolfgang von Goethe nennt den Ausdruck zur gleichen Zeit mehrmals. So findet er sich in der Italienischen Reise aus den Jahren 1786-1788: „der Kaffee, der mir eine ganz eigne triste Stimmung gab.“[21] oder auch in den Maximen und Reflexionen: „…aber es geht doch durch alles etwas tristes hindurch, das einen gewissen gedrückten Zustand andeutet und den Leser, wo nicht niederzieht, doch gewiss nicht erhebt.“[22]
Heinrich Heine nutzt den Begriff in: „Nie hat eines Menschen Wort einen tristeren und schmerzlicheren Eindruck auf mich gemacht.“[23] Auch bei Pückler[24], E. T. A. Hoffmann[25], Fontane[26] und Jean Paul[27] findet sich die Tristesse.
Gottfried Benn titulierte eines seiner bekannten Gedichte Tristesse. Dort heißt es im letzten Absatz, der das Gefühl der Tristesse eindrucksvoll beschreibt:
- „Und dann November, Einsamkeit, Tristesse,
- Grab oder Stock, der den Gelähmten trägt –
- die Himmel segnen nicht, nur die Zypresse
- der Trauerbaum, steht groß und unbewegt.“[28]
1954 erschien in Frankreich Bonjour Tristesse, der erste Roman der 18-jährigen Françoise Sagan über die Trauer des Erwachsenwerdens. Ihr Buch wurde ein internationaler Bestseller und bereits 1958 durch Otto Preminger verfilmt. Der Romantitel wurde im Deutschen zum geflügelten Wort.
Musik
In der Musik wird Tristesse vor allem durch Eintönigkeit erreicht, aber auch schwere Moll-Akkorde erzeugen beim Hörer ein düsteres, tristes Empfinden. Fritz Göttler beschreibt Mozarts Die Zauberflöte als Inbegriff der europäischen Tristesse.[29] Generell gilt, dass der Eindruck, den eine Musik hinterlässt, umso trister ist, je häufiger sie gehört wird. Gute Musik kann jedoch dazu dienen, phantastische Freiräume zu schaffen – als Ansporn, der tristen Realität zu entfliehen.
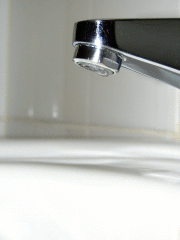
Das Empfinden von Musik ist aber sehr stark mit dem Zeitgeist verknüpft. Zum Beispiel galt Techno, eine Musikrichtung, die stark auf das Stilmittel des Repetitives Arrangements zurückgreift und der so durch ständige Wiederholung einzelner kurzer Fragmente eine gewisse Eintönigkeit innewohnt, in den 1990ern als Symbol für sexuelle Freiheit oder sogar Hedonismus. Fast 20 Jahre später hat sie diese Rolle aber eingebüßt und die innewohnende Tristesse steht stärker im Vordergrund, wie ein namenloser Kritiker bei einer CD-Kritik betont:
- Nun (sic) zehn Jahre später, hat das Modell Techno längst nicht ausgedient, ist aber wieder entweder in jene Subkultur zurückgekehrt, aus der es ursprünglich kam, oder feiert nach wie vor in Großraumdiscos ein gleichsam verwässertes wie schales Dasein, das an biederer Tristesse wohl gemeinhin nicht zu überbieten ist.[30]
Joachim Bessing beschreibt in seinem Buch Tristesse Royal sogar,[31] dass die Empfindung von Musik stark von den Menschen abhängt, die diese Musik hören. So schreibt er:
- Das Konzert ist die Urerfahrung, mit wem du deine Musik teilst. Wenn neben dir Stumpfstudenten stehen, die jede Zeile mitsingen, weil sie es witzig finden, und selbstironisch mitsingen, das ist dann eine ganz harte Grenzerfahrung.
In einigen Subkulturen, wie beispielsweise in der Dark-Wave-Szene, der Gothic- oder der Metal-Kultur, gibt es, wie im Humanismus oder auch in der Romantik, eine Hinwendung zum Gefühl der Melancholie. Hier ist düstere oder auch triste Musik gefragt. Bandnamen, wie der der deutschen Band Tristesse de la Lune oder aus dem lateinischen abgeleitete Bandnamen wie der der norwegischen Gruppe Tristania oder Tristitia aus Schweden verdeutlichen dies. Der Begriff ist in diesem Fall allerdings nicht mehr ausschließlich negativ konnotiert, sondern wird auch für Werbezwecke verwendet.[32] Ästhetisch eher triste Musik ist aber nicht auf diese Subkulturen beschränkt: Bands wie The Cure, Joy Division oder Dead Can Dance sind berühmt für ihre eher depressive und mitunter tristen Stücke. Auch in der Popmusik sind triste Motive immer wieder anzutreffen.[33]
Sehr eintönige Musik findet sich auch in der Minimal Music und in der Musik der Avantgarde. Vor allem in der seriellen Musik wird als ein Stilmittel mitunter ein Ton sehr lange, manchmal minutenlang gehalten. Der Fluxus-Künstler George Brecht komponierte 1963 „Water-Yam“, Stücke aus dem Tropfen eines Wasserhahns. Solche minimalen bis monotonen Stücke sind durch eine große immanente Tristesse gekennzeichnet, häufig wird jedoch beim Hören dieser Art von Musik auch eine Spannung (Suspense) empfunden.
Malerei


In der Malerei spielt das Gefühl der Tristesse vor allem in der Landschaftsmalerei eine große Rolle. Hier kann mit grauen, braunen oder erdigen Tönen oder mit tiefhängenden, schweren Himmeln leicht eine triste Stimmung erzeugt werden.[34]
Beliebt war dieses Motiv in der niederländischen Landschaftsmalerei des späten 17. Jahrhunderts, vor allem Jacob van Ruisdael und Jan van Goyen malen in dieser Zeit oft düstere und schwermütig wirkende Landschaften mit dramatischen Wolkenformationen, absterbenden Bäumen und herabstürzenden Wasserfällen. Diese Bilder werden zu Ausdrucksträgern subjektiver Empfindung und des Gefühls der Tristesse. Seit dem Humanismus avancierte die Melancholie zu einer Modekrankheit, und galt auch in der Romantik als schick. Aus diesem Grund trafen die Bilder bei einem großen Publikum auf Wertschätzung.
Ende des 18. und Anfang des 19. Jahrhunderts war vor allem Caspar David Friedrich für die Tristesse in seinen Bildern berühmt. Er verkörperte den typischen Romantiker: eher introvertiert, weltscheu, naturverbunden und religiös. Seine Bilder werden oft als melancholisch interpretiert. Die Themen kreisten häufig um Sein, Vergehen und Werden, so hat er sich zum Beispiel gefragt:
- Warum, die Frag’ ist oft zu mir ergangen, wählst du zum Gegenstand der Malerei so oft den Tod, Vergänglichkeit und Grab? Um ewig einst zu leben, muss man sich oft dem Tod ergeben.
Dabei entfernte sich Caspar David Friedrich immer mehr von dem zu seiner Zeit verbreiteten Motiv des Erhabenen, das einen angenehmen Schauer auslösen sollte. Statt dieser Erhabenheitsinszenierung schuf er eindringliche Dokumente voller Tristesse. Heinrich von Kleist fasst dies in dem berühmten Text Verschiedene Empfindungen vor einer Seelandschaft von Friedrich in die Worte:
- Nichts kann trauriger und unbehaglicher sein, als diese Stellung in der Welt: der einzige Lebensfunke im weiten Reiche des Todes, der einsame Mittelpunkt im einsamen Kreis. Das Bild liegt, mit seinen zwei oder drei geheimnisvollen Gegenständen, wie die Apokalypse da, als ob einem die Augenlider weggeschnitten wären.[35]
Vincent van Gogh wollte mit betont bunten Bildern der Tristesse des Alltags entfliehen, häufig verwendete er sogar Fehlfarben. Die dunklen Himmel vieler seiner Bilder lassen seine Motive aber dennoch eher trist und bedrückend wirken.[36]
Fotografie und Film
Stilmittel, die in der Malerei für Tristesse stehen, werden mitunter auch in der Fotografie angewandt. Im Gegensatz zu wärmeren, erdigen oder braunen Tönen werden hier aber vor allem kalte Farben wie zum Beispiel blau verwendet, um Tristesse auszudrücken. Bei der Darstellung von Landschaften werden bedrohlich wirkende Himmel mit Hilfe von UV-Filtern, Skylightfiltern und Polfiltern erzeugt. Fotos in Schnee und Regen haben einen sehr geringem Tonwertumfang, was trist und langweilig wirkt.
In der Schwarzweißfotografie werden Orange- oder Rotfilter verwendet, um dramatische und dunkle Himmel zu erzeugen. Dieser Effekt ist mit Digitalkameras und Farbfilmen im Nachhinein nicht simulierbar. Fotos mit starkem Weitwinkel und wenigen oder keinen Personen gelten als trist, die Motivwahl ist hierbei relativ unwichtig.
Karl Lagerfeld verwendete bei seinen Fotos von Claudia Schiffer in Amalfi 1992 bewusst grobkörnige Filme und Regen, ließ sie nach unten schauen. So entstanden Fotos, die trotz der leicht warmen Chamois-Tönung trist und bedrohlich wirken.[37]
Die sowjetische Filmkunst ist berühmt für ihre Darstellung von Tristesse. So verwendet Sergej Eisenstein im zweiten Teil von Iwan der Schreckliche starke Kontraste und Spotbeleuchtung, um bedrohliche oder langweilige Szenen zu dokumentieren. Auch Andrei Tarkowski ist bekannt für minutenlange Kameraschwenks und Plansequenzen, die vor allem in seinem Film Stalker zum Einsatz kommen. Postapokalyptisch anmutende Kulissen verfallender Industrielandschaften, in denen die Natur bereits wieder die Oberhand gewinnt, und der gezielte Einsatz von Schwarz-Weiß-Sequenzen schaffen hier eine dichte Atmosphäre voller Tristheit zwischen Traum, Melancholie und Pathos.
Triste Landschaften sind auch im nordischen Film verbreitet. Bei Nói Albínói, einem isländischen Film von Dagur Kári, wird die Tristesse eines einsamen Dorfes auf Island beschrieben. Der norwegische Film Kitchen Stories von Bent Hamer thematisiert die Alltagstristesse eines einsamen alten Mannes. Der finnische Regisseur Aki Kaurismäki ist berühmt für seine tristen Kompositionen, so dass er als der „Chef-Melancholiker des europäischen Autorenkinos“ gilt.[38]
Im US-Film steht Handlung mehr im Vordergrund; zwar wirken Filme von David Lynch (Lost Highway) oder Russ Meyer (Die Satansweiber von Tittfield) bedrohlich und düster, diese Filme sind jedoch so reich an Action, dass sich Tristesse als Emotion nicht einstellt. Dies gilt auch für Endzeitfilme wie Der Tag danach oder Mad Max, die im Gegensatz zu Stalker, sehr handlungsreich und schnell sind.
Architektur
Während Profanbauten bis ins Mittelalter fast ausschließlich als Zweckgebäude errichtet wurden und nur die wohlhabenden Schichten Bauwerke schmückten, wurde im 20. Jahrhundert begonnen, über Lebensqualität nachzudenken. Innenstädte waren oftmals eng und dunkel, wirkten bedrohlich und wenig attraktiv.
- An den Bauten und ihren Teilen, auch an anderen Dingen und Lebensäußerungen der dazwischenliegenden Jahrhunderte erkennt man deutlich, wie die Menschen freier und bewusster, die Bauten heller und leichter geworden sind. Für den modernen Menschen nicht mehr Festung gegen Feinde, Räuber oder Dämonen, sondern der unaufdringliche, schöne, befreiende Rahmen für das Leben und Gehaben, aufgeschlossen der Natur und doch allseitig ausgezeichnet geschützt vor ihrer Unbill, Tristesse, Wind und Wetter.[39]
In der Architektur wird Tristesse meist synonym für Plattenbauten der 1970er Jahre verwendet. Wie in anderen Kunstrichtungen wechseln sich in der Geschichte der Architektur stark geschmückte Perioden mit weitgehend schmucklosen Stilen ab. Der Modernisme Català mit den bekannten Vertretern Antoni Gaudí und Lluís Domènech i Montaner war dabei eine extrem verspielte Version des in ganz Europa verbreiteten Jugendstils.
- Die Modernisme … fand in privaten und öffentlichen Bauten monumentalen Charakters sowie überschwenglicher Formen und Farben seinen Ausdruck. Er trieb die Handwerkskunst in den Bereichen Keramik, Eisenschmiede und Kunsttischlerei zu neuer Blüte…[40]
Dieser Phase folgte eine triste und schmucklose Phase der Klassischen Moderne, in Deutschland als Bauhaus bekannt.
- Infolge der jammervollen Wohnverhältnisse in den Mietskasernen ist es vielfach sogar den besten Eltern nicht möglich, ihre Kinder körperlich, geistig und seelisch zu tüchtigen Menschen zu erziehen. Die Folgen der Tristesse sind Beschränkung der Kinderzahl und Ehelosigkeit.[41]
Triste Gebäude bestehen aus einfachen geometrischen Formen, meist Quadern. Schmuckelemente sind selten oder nicht vorhanden. Für die Umsetzung dieser Bauform haben sich weitgehend Betonfertigteile durchgesetzt, die eine sehr effektive Bauweise darstellen. Ab Mitte der 1980er Jahre war der Trend zu erkennen, Plattenbauten mit Schmuckelementen zu versehen oder die Bauweise weniger deutlich zum Ausdruck zu bringen. Ein typisches Beispiel hierfür ist das Nikolaiviertel in Berlin-Mitte.
Durch einfache, aber massenhaft einsetzbare Gestaltungsmittel wurde versucht, den tristen Charakter der Gebäude etwas abwechslungsreicher zu gestalten. So wurde als Außenverkleidung gewaschener Kies oder Fliesen verwendet. Die anfangs rechtwinklige Anordnung der verschiedenen Wohnblöcke schafft bei höheren Häusern Schluchten, die die vorhandene Windgeschwindigkeit teilweise drastisch erhöht. Aus diesem Grund ist es in Neubauvierteln quasi nie windstill und die Geräusche des Windes erzeugen eine anhaltende – wenn auch geringe – Lärmemission. Diese Windgeräusche machen derartige Wohngegenden zusätzlich unangenehm. Aus diesem Grund wurden ab etwa 1980 Neubaugebiete nicht mehr durchgängig rechtwinklig errichtet.
Als trist wird auch oft funktionale Industriearchitektur angesehen. Seit der Klassischen Moderne sind Industriebauten weitgehend schmucklos, die Form folgt der Funktion. Farben wurden nur verwendet, wenn sie einen baulichen Grund hatten, beispielsweise als Rostschutz. So entstanden Bauwerke, die allerorten weitgehend gleich aussehen. Dieser Trend wird erst in den letzten Jahrzehnten gebrochen. Industriebauten bleiben weiterhin relativ schmucklos, erhalten aber bunte Farben sowie Farbkontraste.
Ein Beispiel für ein als „trist“ angesehenes Gebäude ist das Wohnhaus „Bonjour Tristesse“ des portugiesischen Architekten Álvaro Siza, das an der Schlesischen Straße Nr. 8 im Berliner Stadtteil Kreuzberg steht. Es wurde 1982/83 erbaut und schließt eine Kriegslücke im Altbaubestand der Straße. Der Entwurf Sizas sah pro Etage eine Ausstattung mit vier großen Wohnungen vor, die durch vier Treppenhäuser erreichbar sein sollten. Außerdem sollten in das Erdgeschoss verschiedene soziale Einrichtungen integriert werden. Aus Kostengründen wurde der Plan jedoch modifiziert: Heute gibt es zwei Treppenhäuser, über die 46 Wohnungen erreichbar sind.
Den Namen bekam das Wohnhaus nicht vom Architekten, sondern durch einen unbekannten Sprayer, der die Worte „Bonjour Tristesse“ auf den gut sichtbaren Giebel des Eckhauses sprühte. Diese Worte wurden oftmals als Kritik an der grauen Fassade gedeutet, die innerhalb des abwechslungsreichen Straßenbildes durch eintönige Fenstergestaltungen in immer gleichen Abständen charakterisiert ist. Eine erkennbar abgesetzte Sockelzone oder einen Dachabschluss, wie er in der 90 Jahre älteren, umgebenden Architektur üblich war, gibt es nicht. Die einzige Abwechslung wird durch eine leicht geschwungene Bauform sowie eine hohe Attika (zurückragender Mauerbereich über dem obersten Geschoss) erreicht.[42]
Literatur
- Françoise Sagan: Bonjour Tristesse. 1. Auflage, Ullstein Taschenbuch Verlag, Berlin 2005, ISBN 3548262775.
- Joachim Bessing: Tristesse Royale. Das popkulturelle Quintett. List Taschenbuch Verlag, Leipzig 2001, ISBN 3548600700.
Weblinks
Einzelnachweise
- ↑ Friedrich Seiler: Die Entwicklung der deutschen Kultur im Spiegel des deutschen Lehnworts. Verlag der Buchhandlung des Waisenhauses, Halle an der Saale 1912, S. 213ff.
- ↑ Augustinus von Hippo: De vera religione, Kapitel 32.
- ↑ Wace: La conception de Notre Dame. Herausgegeben von W. R. Ashford. University of Chicago, Chicago 1933, Seite 469.
- ↑ Bénoît de Sainte-Maure: Roman de Troie. Herausgegeben von L. Constans. Firmin Didot, Paris 1904, Seite 5260.
- ↑ Nicolas Boileau: Le Lutrin. In: Ch.-H. Boudhors (Hrsg.): Odes. 2. Auflage, Paris 1960, Seite 165.
- ↑ Randle Cotgrave: A Dictionarie French and English. Published for the benefite of the studious in that language. Reprint, Edition Olms, Hombrechtikon / Zürich 1977. ISBN 9999082823
- ↑ Léon Cladel: Ompdrailles, le Tombeau-des-Lutteurs. Cinqualbre, Paris 1879, Seite 103.
- ↑ francois.gannaz.free.fr
- ↑ J. M. Stowasser, M. Petschenig und F. Skutsch: Stowasser. Lateinisch-deutsches Schulwörterbuch. Wien 1994, Seiten 524f. ISBN 3209014957
- ↑ Hermann Osthoff: Morphologische Untersuchungen auf dem Gebiete der indogermanischen Sprachen. Olms, Leipzig, Nachdruck 1974. ISBN 3487050803
- ↑ Henry Lewis und Holger Pedersen: A Concise Comparative Celtic Grammar. 3. Auflage, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen, 1989. ISBN 9783525261026
- ↑ Walter Schurian: Psychologie Ästhetischer Wahrnehmungen. Westdeutscher Verlag, Obladen 1986, Seite 61, ISBN 3531117939.
- ↑ Ludwig Wittgenstein: Schriften. Tagebücher 1914–1916. Frankfurt am Main 1960, Seite 179.
- ↑ Walter Schurian: Psychologie Ästhetischer Wahrnehmungen. Westdeutscher Verlag, Obladen 1986, Seite 71. ISBN 3531117939
- ↑ Peter Schneider: Alltag und Exotik. Nexus Verlag, Frankfurt am Main 1988, ISBN 3923301294.
- ↑ Joyce McDougall: Plädoyer für eine gewisse Abnormalität. Psychosozial-Verlag, Frankfurt am Main 1985, Seite 61. ISBN 3898061132
- ↑ Hermann Hesse: Der Steppenwolf. in Gesammelte Werke, Band 10. Suhrkamp, Frankfurt am Main 1987. Seite 208. ISBN 3518381008
- ↑ Siegfried Kracauer: Die Angestellten. Suhrkamp, Frankfurt am Main, 1980. Seite 11. ISBN 3518365134
- ↑ Franz von Gaudy: Die Sixtinische Kapelle. In: Arthur Müller (Hrsg.): Sämtliche Werke. Band 2, Verlag von M. Hofmann & Comp., Berlin 1853, Seite 149.
- ↑ Christian Dietrich Grabbe: Werke. Band 1, Seite 404.
- ↑ Johann Wolfgang von Goethe: Werke, Band 27. Seite 185
- ↑ Johann Wolfgang von Goethe: Werke, Band 21. Seite 100
- ↑ Heinrich Heine: Lutezia, Berichte über Politik, Kunst und Volksleben. 34, Heinrich-Heine-Institut, Hamburg 1990
- ↑ Hermann von Pückler-Muskau: Briefe und Tagebücher. Band 1, Stuttgart 1840-41. Seite 332
- ↑ E. T. A. Hoffmann: Sämtliche Werke in 15 Bänden. E. Griesebach (Hrsg.), Band 8, Leipzig 1900. Seite 137
- ↑ Theodor Fontane: Gesammelte Werke. 1. Serie: Romane und Novellen. Berlin 1890-91. Band 2, Seite 217
- ↑ Jean Paul: Sämtliche Werke. Reimer (Hrsg.) 1826-38, Band 39, Seite 58
- ↑ Gottfried Benn: Tristesse in Sämtliche Gedichte. Klett-Cotta, Stuttgart 1998. Seite 316. ISBN 3608934499
- ↑ Fritz Göttler: Im Geiste Mozarts in Filmmuseum München, Programmheft 01/07 [1] (PDF)
- ↑ CD-Kritik auf Pro7.de
- ↑ Joachim Bessing: Tristesse Royal. Das popkulturelle Quintett. List, Berlin, 2001. ISBN 3548600700
- ↑ Beispiel für die Verwendung des Begriffs Tristesse in einer Kritik einer CD der Band Tiamat
- ↑ Zeit Artikel über Tokio-Hotel „Tristesse für Millionen“
- ↑ Georg Jakob Wolf: Joseph Schmid-Fichtelbergs Landschaften in Die Kunst, Monatshefte für freie und angewandte Kunst XXXXI. F. Brickmann A.-G. München 1920. Seite 104
- ↑ Heinrich von Kleist: Empfindungen vor Friedrich’s Seelandschaft in Reinhold Steig (Hrsg.) Heinrich von Kleist’s Berliner Kämpfe. Spemann,Berlin, Stuttgart, 1901. Seiten 262-268
- ↑ Vincent van Gogh: Sämtliche Briefe. Fritz Erpel (Hrsg.) Henschel-Verlag, Berlin (DDR) 1965–1968, Neuauflage: Lamuv Verlag, Frankfurt am Main, 1985. ISBN 3889770401
- ↑ Karl Lagerfeld: Claudia Schiffer Wilhelm Heyne Verlag, München 1995. ISBN 3453097017
- ↑ Rainer Gansera: Down and Out in Helsinki und Hof, Begegnung mit Aki Kaurismäki. In: epd Film 12/2006, Seite 25
- ↑ Prof. Ernst Neufert, Bauentwurfslehre, Bauwelt-Verlag / Berlin SW 68, 1936, Seite 33
- ↑ Maria Antonietta Crippa und Antoni Gaudí: Gaudi. Von der Natur zur Baukunst. Taschen Verlag, Köln 2003. Seite 11. ISBN 3822824429
- ↑ Handbibliothek für Bauingenieure, Städtebau, Prof. Dr. Otto Blum, Verlag von Julius Springer 1937, Seite 13
- ↑ Hans-Jürgen Mende, Kurt Wernicke (Hrsg): Berliner Bezirkslexikon Friedrichshain-Kreuzberg; Stichwort: Wohnhaus Bonjour Tristesse. Haude & Spencer, Berlin 2003, Seiten 402/403; ISBN 3775904743
